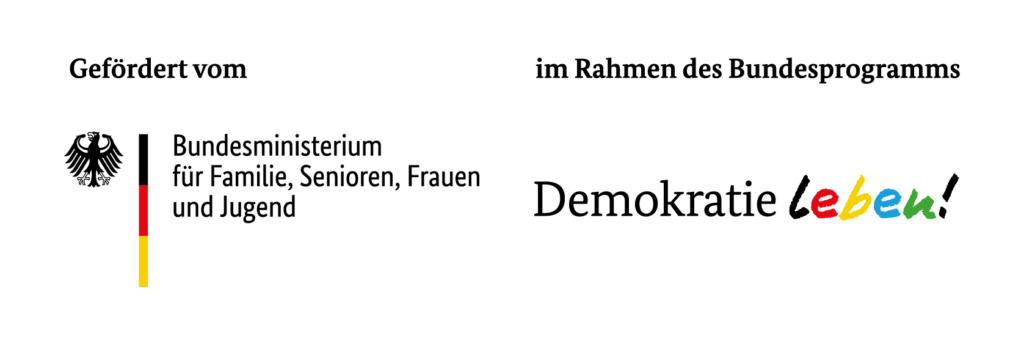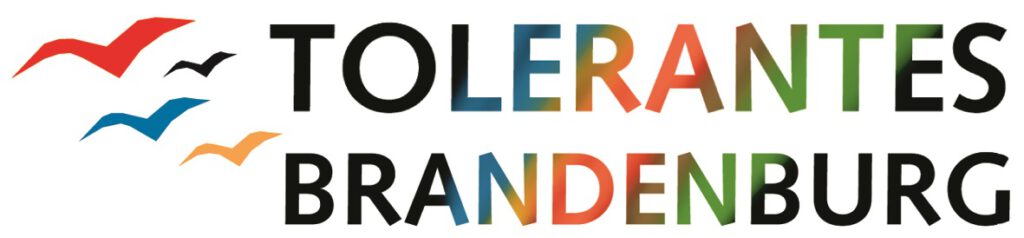Im Rahmen unseres Workshops an der Beruflichen Schulen Potsdamder ASG haben sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit einer besonders ungewöhnlichen Verschwörungserzählung beschäftigt:
„Birds Aren’t Real“.
Der Satz bedeutet übersetzt: Vögel sind nicht echt. Was auf den ersten Blick absurd klingt, hat sich im Internet zu einer eigenen Bewegung entwickelt – und eignet sich hervorragend, um über die Funktionsweise von Verschwörungserzählungen nachzudenken.
Die Idee hinter „Birds Aren’t Real“
Der Ursprung der Erzählung liegt im Jahr 2017. Der US-amerikanische Student Peter McIndoe nahm damals spontan an einer Demonstration in den USA teil – und hielt ein Schild hoch, auf dem stand: „Birds Aren’t Real“. Laut dieser Erzählung sollen alle Vögel in den USA von der Regierung getötet und durch Drohnen ersetzt worden sein, um die Bevölkerung rund um die Uhr überwachen zu können.
Obwohl diese Theorie völlig offensichtlich erfunden war, verbreitete sich die Aktion über soziale Medien rasant. Clips und Bilder von McIndoe und seinem Schild wurden millionenfach geteilt, kommentiert – und teils sogar für bare Münze genommen. Bis heute folgen Hunderttausende dem satirischen Projekt auf TikTok, Instagram und anderen Plattformen.
Satire oder doch eine echte Verschwörungstheorie?
Wichtig ist: „Birds Aren’t Real“ war nie als echte Theorie gemeint. Peter McIndoe bezeichnete sein Projekt früh als satirisches Experiment. Er wollte zeigen, wie leicht sich Menschen im Internet von schrägen Ideen beeinflussen lassen – und wie schnell eine Erzählung, wenn sie emotional anspricht und gut inszeniert ist, Aufmerksamkeit bekommt.
In unseren Workshops diente diese Erzählung als Einstieg in eine wichtige Frage:
Wie erkennt man den Unterschied zwischen echter Kritik, Satire und tatsächlicher Verschwörungserzählung?
Was „Birds Aren’t Real“ lehrt – auch wenn es nicht ernst gemeint ist
– Verschwörungserzählungen brauchen keine Beweise. Oft reicht ein emotional aufgeladener Satz oder ein provokantes Bild, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.
– Satire funktioniert ähnlich wie echte Verschwörungserzählungen – aber mit Absicht zur Aufklärung. Sie überzeichnet, stellt in Frage und will zum Nachdenken anregen.
– Das Internet beschleunigt Verbreitung. Was früher in kleinen Gruppen zirkulierte, kann heute binnen Stunden weltweit sichtbar sein.
– Ironie kann kippen. Selbst wenn eine Idee als Witz gemeint ist, kann sie ernst genommen und weiterverbreitet werden – mit unvorhergesehenen Folgen.
Reflexion im Workshop
In der Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern wurde deutlich: Auch wenn „Birds Aren’t Real“ keine klassische Verschwörungserzählung ist, veranschaulicht sie zentrale Mechanismen:
– Die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen
– Die Suche nach Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit
– Die Rolle von sozialen Medien als Verstärker
– Die Gefahr, dass kritisches Denken durch starke Narrative verdrängt wird
Gleichzeitig wurde betont: Nicht jede ungewohnte oder zugespitzte Aussage ist gleich eine Verschwörungstheorie. Die Grenze zwischen berechtigter Kritik, ironischem Protest und gefährlicher Desinformation ist manchmal fließend – genau deshalb ist das Nachdenken darüber so wichtig.
Fazit
„Birds Aren’t Real“ ist mehr als nur ein Scherz. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Erzählungen im digitalen Raum funktionieren – und wie wichtig es ist, Informationen kritisch zu hinterfragen. Wer darüber lacht, sollte auch fragen: Warum funktioniert das so gut?
Denn genau darum geht es in der „Fake FACTory“: Verstehen, wie Verschwörungserzählungen entstehen, sich verbreiten – und wie man ihnen mit Klarheit, Wissen und Humor begegnen kann.
Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur.de/birds-verschwoerungstheorie-satire-102.html